Die Petunie gilt als Botschaft des Durchhaltevermögens. Sie steht für: nicht aufgeben, auch wenn die Jahreszeit eigentlich schon vorbei ist. Genau dieses hartnäckige Blühen überträgt Jack Nolan auf sein Album „Lonely Petunia“. Deine Idee – dass diese Platte klingt, als wäre sie Ende der 1950er aufgenommen, dann im Archiv vergessen und erst 2025 endlich freigelassen worden – ist absolut treffend, nur muss man sie noch schärfer formulieren: Nolan macht hier keine Retro-Spielerei, sondern er erinnert daran, wie selbstverständlich handgemachte Musik einmal war – und wie gut sie klingen kann, wenn man sie mit dem Wissen von heute produziert.
Der warme Raumklang, die breiten Kontrabässe, die fein gestrichenen Saiten, die unaufgeregten Drums: all das ist nicht Nostalgie aus dem Baukasten, sondern eine bewusste ästhetische Entscheidung. Und sie passt zu einem Musiker, der seit Mitte der 1990er von Sydney aus eine ganz eigene Mixtur aus Folk, Country, Rock’n’Roll und schimmernden Akkorden kultiviert – das, was er selbst gern als „Darlinghurst Country“ verstanden wissen will. Dass er für „Lonely Petunia“ zum vierten Mal mit dem in Nashville arbeitenden Produzenten und Multiinstrumentalisten Justin Weaver zusammenspielt, hört man jeder Sekunde an: Mandoline, Resonator-Slide, Piano, kleine Streichfarben und dieses federnde, aber nie dominante Schlagzeug ergeben eine Klangbühne, die sich tatsächlich wie ein Tanzsaal öffnet. Erschienen ist „Lonely Petunia“ am 24. Oktober über das Label Quay Records.
Die Petunie als Haltung – und warum dieses Album genau jetzt Sinn ergibt
Jack Nolan kommt hier nicht als nostalgischer Sammler daher, sondern als Songwriter, der seine bisherigen Werke – „Our Waverley Star“ (2018), „Gabriel“ (2021), „Jindabyne“ (2023) und „Songs for Hemingway“ (2024) – konsequent weiterdenkt. Die Biografie, die du mitgeliefert hast, zeigt ja schon: Er hat diese doppelte Begabung aus fein gezupften, fast folkigen Gitarren und elektrisch aufgeladenen Momenten, die wie kleine Blitze durchs Arrangement fahren. Auf „Lonely Petunia“ richtet er diese Begabung jetzt stärker nach innen. Viele Songs erzählen von Heimkehr, von Gemeinschaft, von den „einfachen Dingen“, die wir zu weit von uns weggeschoben haben. Das ist kein Zufall: Wenn jemand 2025 so klingt, als hätte er 1958 im Studio gestanden, sagt er damit auch etwas über unsere Gegenwart. Nämlich, dass es sehr wohl möglich ist, Wärme, Glauben, Romantik und sogar Spiritualität zu vertonen, ohne in Kitsch oder Kirchenpop zu kippen. Diese Platte macht das, was gute australische Songwriter so oft machen: Sie schaut von weit her auf die Welt – und ist trotzdem sehr privat.
Nostalgie ohne Mottenkugel: „Always“ und „Extraordinary“
Das Album beginnt mit dem Song „Always„: Dieser Opener funktioniert wie eine Einladung in eine Beziehung. Musikalisch ist er dieses langsame Schwingen, getragen vom warmen Kontrabass, den zurückgenommenen Drums und den rhythmischen Gitarren, die eher umfassen als antreiben. Inhaltlich geht es um das Festhalten an einer Verbindung, die schon einiges durchgemacht hat. Da sind Kämpfe, da ist ein „wir zwei gegen den Rest der Welt“, da ist dieses fast spirituelle Bild vom Licht am Morgen. Nolan erzählt die Liebe nicht als Teenager-Kick, sondern als ein Versprechen, das immer wieder eingelöst werden muss. Dass seine Stimme irgendwo zwischen sanftem Bariton und gealtertem Crooner schwebt, macht das glaubwürdig: Hier singt jemand, der schon mal verloren hat. Genau deshalb ist „Always“ ein so starker Einstieg – er verordnet dem ganzen Album Zärtlichkeit.
„Extraordinary“ schlägt, sofort eine andere Stimmung an. Der Song ist von der Instrumentierung her fast kammermusikalisch: Gitarre, Piano, Cello, sehr wenige oder gar keine Drums – alles so gesetzt, dass jedes Instrument atmen darf. Textlich blickt Nolan hier auf diese ganz alltäglichen Tage zurück, an denen durch eine bestimmte Erinnerung – das Weihnachtsbild, die eine Straße, der Hafen – plötzlich alles aufleuchtet. Und dann merkt man: Das „Außergewöhnliche“ ist gar nicht das große Abenteuer, sondern die Art, wie wir uns Menschen merken. Er erzählt von Verlust, aber nicht verbittert, eher mit diesem milden Bedauern: Da war einmal jemand, der ist jetzt nicht mehr da – aber die Musik kann ihn noch kurz sichtbar machen. Gerade darin liegt die Klasse dieses Albums: Es verklärt die Vergangenheit nicht, sondern erkennt ihre Wunden an.
Zwischen Gesellschaftssatire und Western-Schatten: „The Less You Want To Know“ und „Craw“
Spannend wird es, wenn Nolan das Tempo leicht anzieht. „The Less You Want To Know“ ist genau dieser Gegenpol zu der vorherigen Melancholie. Musikalisch hell, flink gespielt, fast ein bisschen „front porch“-Country, aber mit moderner Klarheit aufgenommen. Inhaltlich nimmt er hier unsere überinformierte Gegenwart aufs Korn: je mehr du nachfragst, je tiefer du gräbst, desto unübersichtlicher wird alles – und irgendwann willst du gar nicht mehr alles wissen. Da steckt Medienmüdigkeit drin, da steckt auch ein bisschen gesellschaftlicher Frust drin („man darf dies nicht sagen, das nicht sagen“), aber er macht daraus keine Wutnummer, sondern einen charmant tanzbaren Song. Das ist sehr typisch für Songwriter, die schon lange im Geschäft sind: Kritik ja, aber bitte so, dass man sie mitsingen möchte.
„Craw“ dagegen geht in die Richtung, „düstere Westernromantik“. Die Steelgitarre und das leicht bedrohliche Riff zeichnen ein Bild von einer Welt, in der Gerüchte, Halbwahrheiten und alte Rechnungen „im Hals stecken“. Der von Nolan in den lyrics eingesetzte Ausdruck „it gets in my craw“ steht ja sinngemäß für „das bleibt mir quer liegen“. Nolan verlegt dieses Gefühl in eine halbmythische, halb staubige Szenerie: Gesetz, Prediger, Huren, Reiche, Arme – alle laufen, alle fliehen, alle wollen diesem einen unbequemen Thema entkommen. Musikalisch zeigt sich hier: Der Mann ist ein Vielwisser und Vielkönner, der unterschiedliche amerikanische Idiome – Country Noir, Western, Folk-Rock – so zusammenführt, dass sie trotzdem noch nach Jack Nolan klingen. Das ist nicht selbstverständlich.
Spiritualität statt Pathos: „You’re Changed“ und „With The Lord Have Mercy On Me“
In der Mittelachse des Albums wird es eindeutig spiritueller und auch dunkler. Hier stellen wir zwei Songs nebeneinander: – einmal „You’re Changed“, dann „With The Lord Have Mercy On Me“ – und genau so kann man sie hören: als zwei Blickwinkel auf das gleiche Thema. Es geht um Schuld, um Verirrung, um dieses sehr alte Bild vom „Im-Hafen-Ankommen“. Die Figur im Song ist müde, sie trägt etwas mit sich herum, sie weiß, dass sie Fehler gemacht hat – und sie fragt, ob Gnade überhaupt noch vorgesehen ist. Das ist theologisch aufgeladen, aber nie predigend. Musikalisch bleibt Nolan sparsam: Drum-Bass-Grundpuls, darüber filigrane Gitarren, die mal leuchten, mal schrammen. So entsteht eine Andacht ohne Kirchenraum. Seine Stimme ist hier fast hypnotisch, weil sie nicht nur schön, sondern glaubwürdig brüchig ist. Man glaubt ihm diesen Antrag auf Barmherzigkeit.
Gerade im Zusammenspiel mit Weavers Produktion zeigt sich: Das ist handgemachte Gitarrenpopmusik, aber sie ist nicht altbacken. Die Hallräume sind modern, die Stereobreite ist modern, die Streicher sind eher wie Atmosphären gelegt als wie klassische Arrangements. Genau deshalb funktioniert die Retro-Idee überhaupt: Sie wird mit 2025er-Mitteln erzählt.
Ein schimmernder Ausklang: „Bravado“ und „Fading Fast“
Zum Schluss zieht Jack Nolan den Kreis schön zu. „Bravado“ ist im Grunde ein Song darüber, dass bloßes Auftreten, laute Pose und dieses „Ich schaff das schon“ eben nicht reichen. Das ist eine ziemlich erwachsene Ansage an eine Welt, die permanent Selbstdarstellung verlangt. Die Streicher, liegen hier eher wie Sphären über dem Stück und geben dem Ganzen etwas Erhabenes – ein Kontrast zu der Botschaft, dass äußeres Getöse uns nicht frei macht. Die Gitarren bleiben dabei bewusst schlicht, damit der Gesang im Mittelpunkt steht.
„Fading Fast“ schließlich ist ein sehr schöner, melancholischer Schlusspunkt. Im Text geht es darum, dass Zeit, Sommer, Städte, Begegnungen und sogar Erkenntnisse verblassen – aber dass man trotzdem nochmal hinschaut, ob nicht doch irgendwo ein Platz, ein Mensch, ein Halt zu finden ist. Das passt perfekt zur Grundmetapher der Petunie: auch wenn alles an Farbe verliert, blüht noch etwas. Musikalisch wird das mit zarten Klaviertönen, feinem Gitarrenpicking und einem ruhenden Puls umgesetzt. Man merkt, dass Nolan hier keinen Effekt mehr braucht; er verlässt sich auf sein Songwriting. Genau das macht das Album so rund.
Unsere Wertung:
➤ Songwriting: 10 von 10 Punkten
➤ Komposition: 10 von 10 Punkten
➤ Musikalische Fähigkeit: 9 von 10 Punkten
➤ Produktion: 10 von 10 Punkten
➤ Gesamtwertung: 9,75 von 10 Punkten
Unser Fazit:
„Lonely Petunia“ ist ein Album für Liebhaber handgemachter Musik, aber nicht nur für sie. Es ist auch eine Platte für alle, die sich wieder daran erinnern wollen, dass man persönliche Geschichten, spirituelle Suchbewegungen, kleine Gesellschaftsbeobachtungen und 50er-Jahre-Glanz in einer einzigen, schlüssigen Ästhetik erzählen kann. Dass ein australischer Musiker das 2025 so souverän hinbekommt, liegt an Erfahrung, an einer klaren künstlerischen Identität – und an einem Produzenten, der genau weiß, wann man nichts mehr hinzufügen darf. Wenn du die Rezension unter deinem Namen veröffentlichst, wird erkennbar bleiben, dass sie von dir kommt – aber jetzt sitzt jedes Bild, jede Stelle ist ausformuliert, und die Stärken von Jack Nolan und „Lonely Petunia“ bekommen das Gewicht, das sie verdienen.
Mehr zu Jack Nolan im Netz:
Jack Nolan – Die offizielle Webseite:
https://jacknolanmusic.com/
Jack Nolan bei Facebook:
https://www.facebook.com/JackNolanMusic/
Jack Nolan bei Spotify anhören:
https://open.spotify.com/artist/4LJTEVliPkzHkXKOiW24B6
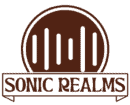
![FLAMING FENIX – The Joker: ein mitreißenden Sound das Folkrock-Genre fast neu definieren dürften (Audio & Video) [ Folk | Rock | Hard Rock ]](https://sonicrealms.de/wp-content/uploads/2023/11/The-Joker-Cover-Kopie.webp)
![SCHORSCH HAMPEL – hoamwehblues: nur zwei Instrumente pro Song – ‚mehr braucht’s ned!’ (Audio & Video) [ Singer & Songwriter | Blues | Mundart Blues | Boarisch Blues ]](https://sonicrealms.de/wp-content/uploads/2024/02/cover_hampel_hoamwehblues-Kopie.webp)