Aus dem us-amerikanischen Seattle kommt eine verdammt spannende Formation auf die Szene zu: Soldiers Of Forgiveness. Album Nummer drei, The Year of Aquarius: Only Poetry Lives Forever, ist dabei nicht einfach „das nächste Kapitel“, sondern ein konsequent durchkomponiertes Opus, das Symphonic Metal, klassischen Heavy Metal, NWOBHM-Galopp und eine Prise Hard Rock so ineinander verhakt, als wären diese Stile schon immer füreinander gedacht gewesen. Und ja: Man spürt in jeder Minute, dass hier Könner am Werk sind – Handwerker, die ihr Material nicht nur bearbeiten, sondern mit ihren Instrumenten eins werden und daraus Klangmalerei treiben.
Wer die Vorgänger The Year Of Capricorn und The Year Of Virgo kennt, weiß: Diese Band denkt in „Runden“, nicht in Singles. The Year of Aquarius: Only Poetry Lives Forever ist laut Konzept die dritte Runde ihres erzählerischen GAME – ein „Quarter Finale“ im Rahmen eines auf zwölf Runden angelegten Zyklus. Die Band bezeichnet sich selbst als „bards from another time“, als Chronisten eines Spiels, das in ihrer Zeit gespielt wird – und genau so fühlt sich dieses Album an: wie ein Bericht aus einer anderen Welt, aber mit sehr echten Emotionen.
Sounddesign als Weltenbau: Druck, Glanz und dieser Sog der Musikalität
Bevor wir in die Songs gehen: Das Sounddesign ist ein Statement. Soldiers Of Forgiveness denken Orchestrierung nicht als „Deko“, sondern als dramaturgische Säule. Synth-Flächen, Chöre, Streicherfarben und Piano-Figuren sitzen nicht zufällig im Mix, sondern legen die emotionale Temperatur fest – und wenn dann Gitarren und Bass reingrätschen, passiert genau das, was du so treffend beschrieben hast: Man wird in einen Sog der Musikalität gezogen. Die Produktion ist klar genug, um Details zu zeigen, aber druckvoll genug, um die Riffs als Rammbock zu fahren. Gerade die Balance aus epischen Keyboardsphären und handfestem Metal-Fundament gelingt beeindruckend selbstverständlich.
Das Beeindruckendste: Die Arrangements lassen Luft. Selbst wenn im Hintergrund Chöre und Orchesterlayer stapeln, bleibt die Rhythmusfraktion tight, das Low-End satt, und die Leadgitarren bekommen ihre Bühne – mal als melodischer Haken, mal als „Guitar Hero“-Moment, mal als feines Ornament. Es ist dieses „prächtige Klangfarben“-Prinzip: nicht zugeschmiert, sondern bewusst koloriert.
„Part“-Struktur und Story: Von der Poeten-Seele bis zur inneren Zersetzung
Das Album ist in große Abschnitte gegliedert: „Dystopian Dreams“ und mehrere Interludes rahmen die Handlung, während die Kernstory über „Part I: The Boy Who Only Wanted to be a Poet“, „Part II: The Enemy Inside“, „Part III: Welcome to the Madness“, „Part IV: Where the Madness Reigns“ und „Part V: Only Poetry Lives Forever“ eskaliert. Inhaltlich folgt man einem Protagonisten – bei dir fällt der Name Joseph – der zwischen Berufung, Krieg, moralischem Anspruch und einem immer lauter werdenden inneren Abgrund aufgerieben wird. Diese Dramaturgie ist keine Staffage: Sie bestimmt Tempo, Instrumentierung und Emotionalität der Tracks.
„Dystopian Dreams“ & „Interlude: The Poet“: Dunkle Ouvertüre, künstlerischer Anspruch
„Dystopian Dreams“ ist die Art Intro, die nicht nur „einleitet“, sondern bereits Welt und Tonfall setzt: düstere Piano- und Synth-Schattierungen, dann der Moment, in dem das Instrumentarium aufspringt und klar macht, wo die Reise hingeht – Mid-Tempo, tight, episch ausgeleuchtet. Direkt danach legt „Interlude: The Poet“ die Karten offen: Hier geht es um Schicksal, Wendung, Werdegang – kurz: um einen Menschen, der eigentlich nur schreiben, beobachten, deuten will, aber in eine Rolle gedrückt wird, die ihm nicht gehört. Dass diese Band Interludes nicht als Füllmaterial versteht, sondern als erzählerische Atemzüge, ist einer ihrer größten Trümpfe.
„Part I: The Boy Who Only Wanted to be a Poet“: Die Geburt einer Tragik
Im Titeltrack des ersten Abschnitts – „Part I: The Boy Who Only Wanted to be a Poet“ – wird der Kernkonflikt gesetzt: ein Kind mit Empathie und innerer Weisheit, das in eine zerrissene Welt hineingeboren wird. Der Song erzählt (ohne zu zitieren) von einem sensiblen Beobachter, der Trost im Nachthimmel findet, dessen „Mutterschaft“ und Schutz aber nur noch symbolisch existieren, bis äußere Gewalt den privaten Kosmos überrollt. Am Ende steht nicht die freie Wahl, sondern der Befehl: Aus dem Poeten wird ein Soldat – nicht, weil er es will, sondern weil die Welt ihn dazu zwingt.
Musikalisch ist das stark: gedrosseltes Tempo, ein druckvolles Fundament, darüber Chorflächen als epischer Rahmen – und im Zentrum ein Gesang, der tatsächlich diesen hypnotischen Zug entwickelt, den du bereits beschrieben hast. Dazu eine Leadgitarre, die nicht „soliert“, sondern Emotionen formuliert. Symphonic Metal als Drama, nicht als Dekoration.
„Evil That Men Do“: Moralischer Spiegel, Maiden-Galopp ohne Cover-Falle
„Evil That Men Do“ trägt den klassischen Heavy-Metal-Galopp im Blut, ohne zur bloßen Referenznummer zu werden. Inhaltlich ist das Stück eine bitterklare Bestandsaufnahme: Du kannst helfen, hoffen, lieben, dich absichern, sogar „optimieren“ – aber das Böse, das Menschen einander antun, bleibt als strukturelle Konstante präsent. Der Text wirkt wie ein Handbuch gegen Selbstbetrug: Wer glaubt, man könne mit dem Bösen „spielen“, hat eigentlich schon verloren. Der Ausweg ist kein Heldentum, sondern Selbstbestimmung und mutiges Leben, bevor Angst dich verwaltet.
Der Refrain-Haken sitzt, die Gitarren sind griffig, und die Keyboards liefern genau diese Sphären, die den Track größer machen, ohne ihn weichzuzeichnen. Das ist Ohrwurm-Metal mit Anspruch – und ja, das bleibt hängen.
„Unquenchable Fire“: Metal-Feuer, das man nicht löschen kann
Du hast es perfekt auf den Punkt gebracht: „Unquenchable Fire“ ist ein Metal-Feuer, das man absolut nicht löschen kann. Inhaltlich verhandelt der Song Glauben, Geld, Moral und Integrität als konkurrierende Kräfte. Unterschiedliche Stimmen (Sinngestalten) versuchen, dem Erzähler ihre Wahrheit zu verkaufen: Himmel als Belohnung, Reichtum als Maß, Armut als Würde. Am Ende kippt das „Feuer“ von äußerer Drohung zu innerem Motor – eine brennende Entschlossenheit, den eigenen Weg zu gehen, selbst wenn die Welt ihn zur „Hölle“ erklärt.
Musikalisch ist das ein Paradebeispiel für die Vielseitigkeit der Band: der elektronische Anriss, dann der schweißtreibende Metal-Antritt, galoppierende Riffs wie ein Schlachtzug auf Pferden, dazu ein Hook, der sich festsetzt. Leidenschaftliche Leads und Soli jaulen, ohne zu nerven – vielmehr wirken sie wie ein zusätzlicher Erzählstrang. Hier schreit alles nach Perfektion: Arrangement, Dynamik, Komposition.
„Autumn Winds“: NWOBHM-DNA, bittersüße Trennungskälte
„Autumn Winds“ trägt die NWOBHM-Fackel mit Stolz: Galopp-Riffs, treibende Drums, Bass als Rückgrat – und darüber diese mystischen Synth-Schichten, die Härte nicht abpolstern, sondern Atmosphäre aufladen. Inhaltlich ist das Stück eine Trennungs- bzw. Ernüchterungsgeschichte: Sommerhitze macht Liebe grenzenlos, doch der Herbstwind ist der Moment der Wahrheit. Was warm und ewig wirkte, wird plötzlich kalt, Räume füllen sich mit Abwesenheit, und die Frage bleibt stehen: War es Liebe – oder nur ein Traum?
Der besondere Kick liegt in den Kontrasten: klarer Gesang mit punktuellen raueren Akzenten, dazu ein Solo im gedrosselten Tempo, das wie ein letzter Blick zurück wirkt. Episch, ohne kitschig zu werden – ein echtes Highlight.
„Interlude: The Rebel“ & „Part II: The Enemy Inside“: Wenn der Frieden die Dämonen weckt
Nach „Interlude: The Rebel“, das den nächsten Wendepunkt wie ein erzählerisches Messer ansetzt, kommt „Part II: The Enemy Inside“ – und hier wird’s psychologisch. Inhaltlich ist das die Geschichte eines Mannes, der jahrelang „funktioniert“ hat: Schlachten geschlagen, Rollen erfüllt, anderen geholfen, sich selbst zuletzt gestellt. Doch genau im Frieden, wenn das Außen schweigt, wird das Innen laut. Der „Feind“ ist nicht mehr vor den Toren, sondern im Herzen: das zurückgelassene innere Kind, das aus Tränen und Hass gefüttert wurde und nun „das letzte Spiel“ einfordert. Eine erschreckend konsequente Metapher dafür, wie verdrängte Verletzungen irgendwann die Steuerung übernehmen.
Musikalisch passt das: stampfendes Mid-Tempo, choral aufgeladen, tiefe Rhythmusarbeit, darüber melodische Leadarbeit als dramaturgischer Scheinwerfer. Das Arrangement wirkt wie ein langsam zuziehender Kreis – und genau darum funktioniert der Track so gut.
„Children of the Moon“ & „Never Die“: Hymnen zwischen Trotz, Wärme und Unsterblichkeit
„Children of the Moon“ ist direkter, griffiger, weniger verschnörkelt – aber keineswegs simpler. Inhaltlich zeichnet der Song eine Gemeinschaft der Außenseiter: gezeichnet, dunkel, missverstanden, aber mit „Herzen aus Gold“. Es geht um Menschen, die in einer harten Welt überleben, ohne ihre Menschlichkeit zu verlieren – und die gerade in Zeiten von Spannung erkennen, wie leicht gute Absichten zur Hölle pflastern können. Eine Art Manifest: Dunkelheit in der Seele heißt nicht Abwesenheit von Güte.
„Never Die“ setzt anschließend den Power-Motor an: zügig, melodisch, mit jaulenden Leads, die sich wie glühende Drähte durchs Arrangement ziehen. Inhaltlich feiert der Song nicht körperliche Unsterblichkeit, sondern Vermächtnis: Sterne können erlöschen, Monumente zerfallen – doch Geschichten, Lieder, Mut und das, was man anderen hinterlässt, überdauern. Der Refrain ist eine Ansage an Passivität: nicht warten, nicht verstecken, nicht auf Rettung hoffen – leben. Das ist Pathos, ja, aber gut verdientes.
„Part III: Welcome to the Madness“: Polka, Jive und der Eintritt ins Theater der Schatten
Dann kommt der Bruch, den du so schön als „fremde Produktion“ beschrieben hast: „Part III: Welcome to the Madness“ verzichtet weitgehend auf Stromgitarren und spielt stattdessen mit einem fast polka- oder cabaret-artigen Vibe. Inhaltlich ist das der Eintritt in eine Welt, in der Realität und Maskerade nicht mehr zu trennen sind: Freakshow-Ästhetik, Zirkusbilder, „smilere“ Versionen alter Ängste. Die Botschaft ist bitter: In der „Madness“ bist du nie allein – weil deine Dämonen immer mit am Tisch sitzen, und weil Deals mit dem Teufel nie ohne Preis sind.
Und genau das ist die Stärke der Band: Sie traut sich, das Soundkostüm zu wechseln, ohne die Story zu verlieren. Das ist nicht nur „mutig“, das ist kompositorisch logisch.
„Part IV: Where the Madness Reigns“ (Acts I–III): Der Metaltango im Abgrund
Das Herzstück ist „Part IV: Where the Madness Reigns“, ein Triptychon im Song – und ein dramaturgischer Höhepunkt. „Act I: The Dance of the Lingering Spirits“ beschreibt den Moment, in dem der Protagonist sich selbst fremd wird: Spiegelbilder, die nicht mehr passen, Schuld- und Kriegsvisionen als „private Hölle“, Frieden als Stille, in der innere Dämonen erst recht singen. Die „Geister“ laden zum Tanz – nicht als Party, sondern als letzte Wiederholung dessen, was man nicht verarbeitet hat. Es ist weniger Horrorfilm als psychologischer Totentanz: Der Mensch wird zum Gefangenen seiner eigenen Erinnerungen.
Ab „Act II: Fall From Grace“ kippt das Ganze zurück in Heavy/Power-Metal-Schärfe: schnelle Gitarren, präzise Drums, ein Sound, der überzeugt und wie ein neuer Metalhammer geschlagen wird. Inhaltlich spricht hier die Versuchung mit klarer Stimme: Lass los, nichts ist real, morgen bringt nur Schmerz – die „Madness“ bietet Erlösung durch Kapitulation. Besonders bitter ist der Twist: Der Protagonist erkennt, dass er nur ein Diener war, ein Werkzeug in einem größeren Spiel, und doch zieht es ihn weiter abwärts, weil die innere Logik der Verzweiflung so verführerisch einfach ist.
„Act III: Welcome To The Death“ schließlich ist makaber und genial zugleich – diese morbide Komik, die du ansprichst, funktioniert, weil sie nicht verhöhnt, sondern entlarvt. Inhaltlich geht es um den gefährlichen Gedanken, Schmerz ließe sich endgültig „abstellen“, um eine Stimme, die endgültige Ruhe als Liebe tarnt und die Leere als Trost verkauft. Der Song zeigt damit nicht „Romantik“, sondern die Manipulation eines gebrochenen Geistes – und genau darum trifft er. Wichtig: Das Stück wirkt wie eine Warnung vor dieser Verführung, nicht wie eine Verherrlichung.
Musikalisch ist dieser Dreiteiler ein Ereignis: erst Streicher/Piano/Chor als Bühnenlicht, dann der harte Umschwung, dann wieder der Tanz, der sich in schwere Gitarren auflöst. Ein Metaltango im Abgrund – und selten war dieser Begriff passender.
„Part V: Only Poetry Lives Forever“: Ballade, Requiem, Lebensbilanz
Mit „Part V: Only Poetry Lives Forever“ kommt die große, menschliche Klammer. Inhaltlich ist das ein Abschied am Grab – aber nicht als kitschige Trauerszene, sondern als Lebensbilanz: Wir sind alle nur „auf der Durchreise“, Rollen in einem Spiel, und am Ende zählt, was wir hinterlassen. „Poesie“ steht dabei für alles, was den Tod überlebt: Worte, Melodien, unausgesprochene Wahrheiten, Trost, Liebe – kurz: Bedeutung. Der Song macht aus Endlichkeit keinen Schrecken, sondern eine Aufforderung, Spuren zu hinterlassen, die andere tragen können.
Auch hier: Sounddesign und Komposition sind groß. Erst zerbrechlich, dann kraftvoller, aber nie überladen; eine Ballade, die nicht weichgespült ist, sondern Würde hat. Dass danach „Interlude: The Legacy“ (erzählerisch, akustisch) und „The Dance of the Owls“ (leichtfüßiger, verspielt, virtuos) folgen, fühlt sich an wie das Ausatmen nach der Katastrophe: Die Welt dreht sich weiter, aber anders.
„Illusions and Dreams“: Schlaflied, Abrechnung, letzter Vorhang
Das Finale „Illusions and Dreams“ wirkt wie eine Spieluhr auf Orchesterbett – und genau das ist die Pointe. Inhaltlich erzählt der Song in Stationen das Erwachsenwerden als Entzauberung: erst Wunder, dann Pflichten, dann Krieg, dann die Erkenntnis, nur Figur in fremden Plänen gewesen zu sein – und am Ende das innere Kind, das zu spät zurückgeholt wird. „Schlaf“ und „Traum“ sind hier keine Romantik, sondern Schutzmechanismen: Illusionen als Decke gegen eine Welt, die zu früh zu viel verlangt.
Wenn die schweren Gitarren wieder in den Mix schwenken, ist das wie der letzte Realitätscheck – und doch bleibt es melodisch, hymnisch, orchestriert. Ein würdiger Schlusspunkt, der die Idee des Albums – Story, Poesie, Spiel, Mensch – noch einmal bündelt.
Unsere Wertung:
➤ Songwriting: 10 von 10 Punkten
➤ Komposition: 10 von 10 Punkten
➤ Musikalische Fähigkeit: 9 von 10 Punkten
➤ Produktion: 10 von 10 Punkten
➤ Gesamtwertung: 9,75 von 10 Punkten
Unser Fazit:
Ein episches Konzeptalbum, das musikalisch und erzählerisch trägt
Soldiers Of Forgiveness liefern mit The Year of Aquarius: Only Poetry Lives Forever ein Konzeptalbum, das in beiden Disziplinen überzeugt: musikalisch, weil Sounddesign, Arrangement und Komposition auf Profi-Niveau ineinandergreifen; erzählerisch, weil die „Parts“ nicht Behauptung sind, sondern echte Dramaturgie. Du bekommst Galopp-Riffs und Doublebass, Chöre und Streicher, harte Gitarren und cabaretartige Brüche – und trotzdem fällt das Album nie auseinander. Im Gegenteil: Gerade die stilistischen Schlenker machen die Story glaubwürdiger, weil psychische Zustände selten linear sind.
Das ist epischer Symphonic Metal mit Heavy-Metal-Seele, geschrieben von Leuten, die Ohrwürmer können, ohne platt zu werden – und die den Mut haben, ihr Konzept ernst zu nehmen. Wer auf Storytelling steht, wer gern in Klangfarben badet und trotzdem Riffs zum Headbangen braucht, ist hier goldrichtig.
Mehr zu Soldiers Of Forgiveness im Netz:
Soldiers Of Forgiveness bei Instagram:
https://instagram.com/soldiers4give
Soldiers Of Forgiveness bei den (Musikdiensten):
https://linktr.ee/soldiers4give
Soldiers Of Forgiveness bei Spotify anhören:
https://open.spotify.com/artist/2M5Fdo4RMCxofPLgy05Uiv
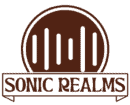
![SPEED LIMIT – Anywhere We Dare: Die Salzburger Melodic Metal-Pioniere kehren nach über 7 Jahren mit einem mächtigen Album zurück (Audio & Video) [ Hard Rock | Melodic Metal ]](https://sonicrealms.de/wp-content/uploads/2023/08/cover_1503482871715683.jpg.webp)
![SOULDRINKER – War Is Coming: Ein Sound so wundervoll wie gewaltig … (Audio & Video) [ Heavy Metal ]](https://sonicrealms.de/wp-content/uploads/2023/08/Cover-vorlaeufig-Kopie.jpg.webp)