Beetlejuice Beetlejuice steht für eine besondere Sorte Fortsetzung: jene, die Jahrzehnte nach dem Original entstehen und damit zwei Zeithorizonte versöhnen müssen – Erinnerungen, die längst zu popkulturellem Mythos geronnen sind, und eine Gegenwart, die andere Tempi, Rituale und Befindlichkeiten kennt. Späte Sequels sind wie Geisterbeschwörungen in einem Museum: Man ruft nicht nur Figuren, sondern ganze ästhetische Epochen herbei – in der Hoffnung, dass sie heute mehr sind als bloß polierter Nostalgieglanz. Allzu viele Rückkehrer erstarren an der eigenen Ehrfurcht oder kippen ins reine Fanservice-Theater. Tim Burtons neues Kapitel findet die seltene Zwischenlage: „Beetlejuice Beetlejuice“ nutzt den Kult von 1988 als Humus für etwas Eigenes – dramaturgisch klarer, thematisch reifer, visuell haptischer – und hat die Ruhe, im richtigen Moment den Gag laufen zu lassen oder der Stille zuzuhören.
Synopsis (spoilerarm)
Nach einem familiären Verlust kehren drei Generationen der Deetz-Familie nach Winter River zurück. Winona Ryders Lydia, inzwischen halb Ikone, halb Gespenst ihres eigenen Medien-Ichs, manövriert zwischen Persona und echter Melancholie; ihre Tochter Astrid, gespielt von Jenna Ortega, hält die Spukvergangenheit der Mutter für Pose, bis ein Ritual misslingt und die Tür ins Jenseits wieder aufspringt. Auftritt: Michael Keatons Betelgeuse – Trickster, Parasit, Jahrmarkts-Entertainer mit Leichengeruch –, der das emotionale Vakuum wittert und die Familie tiefer in eine bürokratisch sortierte Zwischenwelt zieht, in der Warteschlangen, Formulare und alte Rechnungen den Ton angeben. (Weltpremiere als Eröffnungsfilm in Venedig am 28. August 2024; internationaler Kinostart Anfang September; offizielle Laufzeit: 104 Minuten.)
Der Film spannt drei Reibungsflächen auf: Trauerarbeit als Familiendrama, Ruhm als Maskenspiel – und das Jenseits als Verwaltungsfarce, die unsere Gegenwart besser spiegelt, als uns lieb sein kann. Das Ergebnis ist keine Nostalgiepflege, sondern eine Bewegung: Die Vergangenheit kehrt nicht zurück, um sich selbst zu bestätigen, sondern um Antworten zu erzwingen – von Lydia, von Astrid, und vom „Geist mit dem meisten“ selbst.
Zwischenruf aus der Realität: Mein Philipp jedenfalls mampfte amüsiert über das cineatische Schauspiel im Kinosaal das Popcorn und schlürfte an seiner Pepsi (ja, okay, ich geb’s zu: das ist unser Chefredakteur, mit dem ich liiert bin; er zwingt mich mit Liebesentzug, diese Kritik zu schreiben). Manche beschwören dreimal seinen Namen – ich probiere dreimal „Beziehungsdynamik“ und hoffe, der Dämon der Deadlines verschwindet.
Dramaturgie & Erzählrhythmus
„Beetlejuice Beetlejuice“ entfaltet seine Handlung in drei sauberen Bewegungen: Zuerst etabliert der Film die fragile Ordnung der Hinterbliebenen; dann zersetzt der Eindringling aus der anderen Seite dieses Gleichgewicht; schließlich verschraubt ein Finale Privates und Kosmisches, sodass Entscheidungen Folgen haben, die nicht weggewitzelt werden. Setpieces sind präzise als Scharniere gesetzt – Beerdigung, Fehlbeschwörung, Behördenhölle im Afterlife, eine regelverliebte Schlussbeschwörung –, und sie erzählen Figur, nicht nur Effekt. Dass das in kompakten 104 Minuten gelingt, ohne Kirmes-Hektik und mit spürbarem Atem zwischen den Gags, ist eine der elegantesten Leistungen dieses Sequels.
Wiederholungen aus dem Klassiker dienen nicht als Schaustücke, sondern als rhetorische Figuren: Wenn alte Motive zurückkehren, verändern sie die Lage. Resignation wird Wahl, Witz wird Waffe, Erinnerung wird Vertrag – und Betelgeuses Hunger nach Bühne wird zum Spiegel menschlicher Sehnsucht nach zweitem Blick.
Schauspiel & Figuren
Michael Keaton stürmt ins Bild wie eine schlecht erzogene Jahrmarktsattraktion und reißt das Gravitationsfeld an sich: Timing als Waffe, Körperkomik mit Sumpfblüte, dazu dieses grinsende Versprechen, gleich alles schlimmer und zugleich interessanter zu machen. Winona Ryder spielt Lydia als Paradox – Ikone und Gefangene ihrer Legende –, und findet jene stillen Töne, in denen Trauer nicht ins Pathos kippt. Catherine O’Hara schneidet Delia erneut als funkelnde Linie zwischen Selbstironie und echter Zuneigung. Jenna Ortega gibt Astrid eine störrische Skepsis mit weichem Kern; ihr Trotz ist weniger Rebellion als Selbstschutz – genau das macht die Figur tragfähig. In präzisen Nebenbahnen glänzen Monica Bellucci (Delores) als elegante Gefahr aus dem Off der Ewigkeit, Willem Dafoe (Wolf Jackson) als toter Ex-B-Movie-Cop im Behördenapparat des Jenseits und Justin Theroux (Rory) als Produzenten-Schmierfink, dessen Charme stets eine Quittung verlangt. Ergänzt wird das Ensemble u. a. durch Arthur Conti, Nick Kellington, Santiago Cabrera, Burn Gorman, Danny DeVito und Sami Slimane. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
Das Entscheidende: Jede Figur wird zur Entscheidung gezwungen – über Loyalität, Wahrheit, Ruhm, Familie. Antagonisten sind selten monolithisch „böse“; sie folgen Motiven, die aus ihrer Perspektive Sinn ergeben. Diese innere Logik erdet die barocke Bildwelt und hält die Komik auf Kurs.
Regiehandschrift, Bild & Klang
Burton vertraut wieder auf Textur: Puppenspiel, Prothesen, Setstücke, die man greifen möchte; Digitales würzt, dominiert aber nie. Haris Zambarloukos’ Kamera modelliert Gesichter und Räume im Wechsel von Theaterlicht und Grabesdämmerung; Jay Prychidny schneidet musikalisch, ohne dem Score hinterherzuhecheln. Danny Elfman steuert einen Sound zwischen Moritat und Zirkuswalzer – nie Tapete, immer Motor –, ergänzt um eine kuratierte Auswahl lizensierter Stücke und ein hörbar „erweitertes“ Hauptthema. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
Die Ausweitung des Afterlife in Richtung Behörden- und Callcenter-Satire ist mehr als ein Gag: Sie ist Gegenwartskommentar. Das Totenreich als Verwaltungseinheit, die Gefühle normiert und Vorgänge kennziffert, fühlt sich (leider) sehr 2024 an – und verlängert das Worldbuilding des Klassikers sinnvoll in unsere Zeit.
Themen & Motive
Identität als Maske; Trauer als Vertrag; Ruhm als Exorzismus. Die Wiederkehr des Vergangenen dient hier nicht als Schulterklopfen, sondern als Prüfstein: Wer sind wir, wenn die Ikonen wieder sprechen – und was schulden wir ihnen, was schulden sie uns? Der Film beantwortet das nicht mit Zynismus, sondern mit einer Heiterkeit, die sich Melancholie leisten kann.
Highlights & Setpieces
➤ Die Beerdigung als Startschuss eines Rituals, das mehr öffnet, als die Beteiligten wollen – Trauer, Show, Schuld in einer Einstellung verschraubt.
➤ Die Behörden-/Callcenter-Hölle des Afterlife: spitze Satire, die die Logik administrierter Gefühle seziert und den Klassiker in die Gegenwart verlängert.
➤ Die große Beschwörung im Schlussakt, die Komik, Gefahr und Gefühl in einer einzigen Bewegungsfigur bündelt – Regelwerk als Drama, nicht als Fußnote.
➤ Ein Lydia-Solo, leise gespielt, das zeigt, wie nah Wärme und schwarzer Humor beieinander liegen.
Vergleich mit dem Original (1988)
Der Kultfilm war eine anarchische Geisterbahnfahrt mit Calypso-Klamauk und expressionistischen Kulissen; das Sequel behält die Frechheit, kuratiert aber strenger. Wo 1988 vieles als assoziatives Spektakel verströmte, bindet 2024 die Schauwerte enger an Konflikte und Entscheidungen – ohne Leichtigkeit zu verlieren. Auch ökonomisch erzählt die Geschichte weiter: Das Original lief weltweit auf rund 74 Mio. US-Dollar hinaus; „Beetlejuice Beetlejuice“ übertrifft das global deutlich und bestätigt, dass Burtons Handschrift im großen Saal immer noch zieht. :contentReference[oaicite:4]{index=4}
Tempo, Struktur & Klarheit
Der Film stapelt nicht, er verdichtet. Jede Sequenz hat Zweck, jede Pointe sitzt, und die Effekte dienen der Szene, nicht andersherum. Wo der Plot sich gelegentlich einen Extradreh gönnt, bleibt der Kompass bei der Figur, nicht beim Gimmick. Dass die Laufzeit dabei schlanke 104 Minuten bleibt, ist kein Zufall, sondern Haltung.
Box Office (weltweit):
ca. 452 Mio. US-Dollar
Kleine Schönheitsfehler (ohne die Bilanz zu trüben)
Ein, zwei Ideen wollen ins Bild, obwohl die Szene sie nicht unbedingt braucht; das gehört zur Burton’schen Lust an der Überformung. Doch weil die Wendungen stets auf Figur zielen, nie bloß auf Schaustück, bleiben auch diese Ausschläge Teil des Charmes – eine Patina aus Überschwang, die hier zum Material der Erzählung gehört.
Manche Handlungsstränge im Film wirken deutlich lose und manchmal merkt man von Szene zu Szene gar nicht, oder zumindest: zunächst nicht, wo der Zusammenhang besteht. Hier könnte stellenweise Verwirrung bestehen
Unser Fazit:
So atmen Fortsetzungen, die Jahrzehnte später kommen: Sie mumifizieren die Vergangenheit nicht, sie kompostieren sie – als Nährboden für etwas Eigenes. „Beetlejuice Beetlejuice“ flirtet mit der alten Liebe, ist ihr aber nicht hörig; er erlaubt sich gleichzeitig Albernheit und Anrührung, Bosheit und Großzügigkeit. Ein würdiger Nachfolger – und, ja, besser als das Original.
Besetzung und Details
Produktionsfirmen / „Filmstudio“
- Warner Bros. Pictures
- Plan B Entertainment
- Tim Burton Productions
- The Geffen Company (studio credit)
- Domain Entertainment (in association)
- French Film Company (in association)
Regie
- Tim Burton
Showrunner / Drehbuch
- Alfred Gough & Miles Millar (Screenplay; Story u. a. mit Seth Grahame-Smith)
Musik
- Danny Elfman (Score; Soundtrack via WaterTower Music)
Mehr zu Beetlejuice Beetlejuice im Netz
Offizielle Website:
https://www.beetlejuicemovie.com/
Warner-Bros.-Filmseite:
https://www.warnerbros.com/movies/beetlejuice-beetlejuice
Instagram (offiziell):
https://www.instagram.com/beetlejuicemovie/
Facebook (offiziell):
https://www.facebook.com/BeetlejuiceMovie/
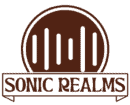
![Final Destination – Der Anfang der Kulthorrorfilm-Serie in der Kritik (Trailer) [ Horror | Mystery | Teenhorror ]](https://sonicrealms.de/wp-content/uploads/2023/08/IMG_2794-683x1024.png.webp)
![Return Of The Living Dead 4: Hell Mary – Die nie erschienene Fortsetzung die wahrscheinlich genial gewesen wäre! [ Horror | Schocker | Zombiefilm]](https://sonicrealms.de/wp-content/uploads/2023/08/Return-Of-the-Living-Dead-Hell-Mary-Art-Aug-2023.jpeg.webp)