Wenn Dyed In Grey etwas seit den Tagen von The Abandoned Part (2013) und der EP The Forgotten Sequence (2015) bewiesen haben, dann das: Diese Band aus New York denkt Komposition nicht in Riffs, sondern in Dramaturgie. Spätestens mit Anguish and Ardor (2018) – dem rein instrumentalen Statement, das Jazz-Fusion-Farbigkeit und Metal-Präzision auf engstem Raum verhandelt – war klar, dass hier keine Genre-Schublade lange geschlossen bleibt. Mit Harbinger folgt nun der nächste Schritt: dunkler, dichter, zugleich zwingender im Fluss. Das Album wirkt wie ein Vorzeichen im Wortsinn – nicht als billiger Omen-Slogan, sondern als konsequent durchinszenierter Sog aus Atmosphäre, Technik und Emotion
Und ja: Das ist progressiver Metal, der sich nicht in Mathe-Aufgaben erschöpft. Dyed In Grey bauen polyrhythmische Vertracktheit nicht als Selbstzweck, sondern als Sprache. Jede Taktverschiebung trägt Bedeutung, jede Pause sitzt, jede Rückkehr der Motive fühlt sich verdient an. Dazu kommt ein Sounddesign, das den Spagat meistert: klinisch präzise, ohne steril zu werden; wuchtig, ohne den Raum zuzukleistern. Gitarren atmen, Bass hat Wärme und Körper, Drums stehen messerscharf im Panorama – und über allem eine vokale Performance, die zwischen baritonaler Intimität und kontrollierter Aggression genau die richtigen Hebel findet.

Produktion, Sounddesign und Kompositions-Handwerk
Der größte Trumpf von Harbinger ist die Balance: Heaviness als Gewicht, nicht als Dauerfeuer. Die Verzerrung kommt dann, wenn sie dramaturgisch gebraucht wird – und gerade dadurch trifft sie härter. Clean-Gitarren wirken nicht wie „Intro-Pflichtprogramm“, sondern als erzählerisches Werkzeug: mal sommerlich-licht, mal kühl schimmernd, mal wie ein trügerischer Ruhepol, bevor die Rhythmusfräse einsetzt. Das Schlagzeugspiel ist tight, aber nicht roboterhaft; Ghostnotes, Akzentsetzungen und dynamische Übergänge lassen die Patterns leben. Der Bass arbeitet nicht nur als Fundament, sondern als dritter Erzähler zwischen Harmonie und Groove – warm, präsent, oft mit subtiler Melodieführung.
Bemerkenswert ist außerdem, wie organisch die komplexen Arrangements wirken. Viele Bands schreiben „kompliziert“ und versuchen danach, es musikalisch bewohnbar zu machen. Dyed In Grey gehen den umgekehrten Weg: Sie schreiben Songs, die atmen – und füttern diese Songs dann mit technischer Raffinesse. Ergebnis: Du kannst Harbinger am Stück hören, ohne Ermüdungserscheinungen. Weil es eben nicht nur „noch ein Part“ ist, sondern eine Kette aus Spannungsbögen, die sich gegenseitig tragen.
Track für Track: Songs als Kapitel eines dunklen Omen-Romans
Sunbird – Komplex im aber nicht Verkopft
„Sunbird“ ist der Opener, der sofort klarstellt, wofür Dyed In Grey stehen: präzise, aber nicht kalt; komplex, aber nicht verkopft. Das Stück startet mit cleanen Gitarren, die eher in Cinematic-Weite als in „Djenty“-Raster passen, während Drums und Bass den Anker setzen – bombenfest, doch federnd genug, um den Song atmen zu lassen. Im mittleren Tempo entfaltet sich eine Komposition, die sich wie ein Panorama öffnet: erst idyllische Ruhe, dann das Gefühl, dass sich am Horizont etwas zusammenbraut. Wenn gegen Ende die Stromgitarren zupacken, wirkt das wie der Sturm nach dem Licht. Inhaltlich lässt sich „Sunbird“ als trügerische Hoffnung lesen – ein letzter warmer Blick nach oben, bevor die eigentliche Reise in die Schatten beginnt.
Ascent – Musikarbeit gegen Widerstand
„Ascent“ zieht das Tempo an und demonstriert, wie gut Dyed In Grey Hook und Härte zusammenbringen. In den Strophen dominiert klarer Gesang, der nicht geschniegelt wirkt, sondern erzählerisch – als würde der Sänger dich am Kragen packen und durch die nächste Kurve ziehen. Dann der Refrain: Heavy as fuck, aber präzise gesetzt, mit aggressiven Shouts als Gegengewicht zur melodischen Leitlinie. Auch der Chorgesang sitzt wieder so, dass er nicht nach „Stadion“ klingt, sondern nach innerem Echo. Thematisch ist „Ascent“ die naheliegende Aufwärtsbewegung – nicht unbedingt Sieg, eher: der Wille, sich aus dem eigenen Sumpf herauszuziehen. Der Song klingt wie Muskelarbeit gegen Widerstand.
Absinthe And Dead Butterflies – melancholische Eleganz trifft auf heftiges Aufbegehren
Mit „Absinthe and Dead Butterflies“ kippt das Licht endgültig. Düsterer Einstieg, ein Sounddesign, das sich wie Nebel um die Akkorde legt, und dann diese Baritonstimme: ergreifend, warm, tragend – als würde jemand eine Wahrheit aussprechen, die längst überfällig war. Die Strophen bauen Spannung über Nuancen auf, während der Refrain die Tür zur Heaviness aufstößt, ohne dass der Song jemals „anstrengend“ wird. Genau das ist die Kunst: Härte als organischer Teil eines Flusses. Inhaltlich schreit der Titel nach dekadenter Selbstbetäubung und zerbrechender Unschuld – Absinth als Rausch, „tote Schmetterlinge“ als verlorene Leichtigkeit. Die Musik übersetzt das in ein Wechselspiel aus melancholischer Eleganz und heftigem Aufbegehren.
Mirrored Ruins – Ein Spiegel der musikalischen Perfektion
„Mirrored Ruins“ beginnt wie ein Ritual: mystische Tonlagen, ein Hauch von unheilvoller Größe, dann schwenkt der Song in griffige Härte, ohne seine Schatten zu verlieren. Besonders stark ist hier die vokale Spannweite – von baritonaler Wärme bis zu souveränen Shouts, die nicht einfach „Wut“ transportieren, sondern Dringlichkeit. Ab etwa der dritten Minute bricht das Stück endgültig auf: Doublebass treibt, die Gitarren werden aggressiver, gutturale Akzente reißen Löcher in die Textur – und darüber ein Gitarrensolo, das nicht nur virtuos ist, sondern leidenschaftlich erzählt. Der Titel legt nahe, dass es um Selbstbilder und Zusammenbruch geht: Ruinen, die wir im Spiegel erkennen, weil wir sie selbst mitgebaut haben. Musikalisch passt das perfekt – erst reflektiert, dann kompromisslos.
Static Tides das grande Finale – Prog at it’s Best!
„Static Tides“ setzt wieder stärker auf Eingängigkeit – aber nicht im Sinne von „einfach“, sondern im Sinne von „klar“. Arpeggio-artige Leadgitarren legen eine schimmernde Oberfläche über griffige Rhythmusinstrumentalisierung, das Tempo bleibt im mittleren Bereich, und doch wirkt alles wie ein finales Aufatmen. „Statische Gezeiten“ – das klingt nach Bewegung, die feststeckt: nach Wiederholung, nach Kreislauf, nach dem Versuch, aus Mustern auszubrechen, die einen immer wieder zurückziehen. Musikalisch lässt der Song Raum, ohne Spannung zu verlieren, und setzt damit einen Schlussstrich, der nachhallt statt abzuwürgen.
Silent Symetry – Wie ein Prog Metal Herzschlag unter Glas
„Silent Symmetry“ ist ein Lehrstück in Sachen Progressive Metal: komplexe Arrangements, die dennoch „singen“, und ein Wechselspiel aus Ruhe und Druck, das wie eine Gezeitenbewegung wirkt. Die Band denkt in Ebenen: vorne die Leads, die oft arpeggiert schimmern; darunter Rhythmusgitarren, die nicht nur schieben, sondern harmonisch kommentieren; und im Unterbau ein Bass/Drums-Gespann, das so präzise ist, dass jede Verschiebung wirklich Bedeutung bekommt. Inhaltlich klingt „Silent Symmetry“ nach dem Versuch, Ordnung im Chaos zu finden – eine stille Symmetrie inmitten innerer Unruhe. Genau so fühlt sich der Song an: kontrolliert, aber emotional geladen, wie ein Herzschlag unter Glas.

Tempest – Ein Heavy Brecher mit Durchschlagkraft
„Tempest“ macht dem Titel alle Ehre: ein Heavy-Brecher, der sofort draufprügelt und trotzdem nicht stumpf wirkt. Tiefe Gitarrenstimmungen liefern Volumen, der Bass füllt die Räume dazwischen, und das Schlagzeug treibt im mittleren Tempo mit einer Autorität, die jeden Break zur Ansage macht. Im Vers dominieren Shouts und gutturale Farben, der Refrain öffnet sich mehrstimmig und klar – ein Kontrast, der nicht nur „nett“ ist, sondern die emotionale Kante schärft. Inhaltlich liest sich „Tempest“ wie ein innerer Orkan: Kontrollverlust, Reinigung, Zerstörung als Vorbedingung für Neubeginn. Die Band vertont das, indem sie Sturm nicht als Dauerblast, sondern als wechselnde Fronten erzählt.
Descent – Songaufbau der komplexen Sorte
Und weil Harbinger nicht auf lineare „Heldengeschichte“ macht, folgt zum Abschluss „Descent“ – der Absturz, der logisch ist und weh tut. Hier regiert Druck: kompromisslose Heaviness, verschachtelte Rhythmik, ein Songaufbau, der immer wieder den Boden wegzieht. Gutturale Vocals eröffnen, später verschränkt sich das mit klarem Gesang und Chorflächen – als würden mehrere Stimmen im Kopf gleichzeitig argumentieren. Inhaltlich wirkt „Descent“ wie der Moment, in dem Verdrängung nicht mehr funktioniert: Du kannst dich nicht hochlügen, du musst durch die Tiefe. Dass die Band diese Schwere mit kompositorischer Eleganz fängt, ist eine der großen Stärken des Albums.
Was Harbinger besonders macht: Emotion in der Technik
Viele progressive Platten beeindrucken – und bleiben trotzdem auf Distanz. Harbinger ist anders, weil es den „klinischen“ Vorteil moderner Produktion nimmt, ohne die menschliche Unruhe zu glätten. Die Virtuosität ist überall, aber sie wird nicht ausgestellt. Man merkt, dass hier mit kompositorischer Weitsicht gearbeitet wurde: Themen kehren wieder, Stimmungen werden gespiegelt, Spannungsbögen werden nicht zufällig gelöst, sondern bewusst geführt. Das Album hat diese seltene Qualität, zugleich Kopfhörer-Futter für Detail-Nerds und Bauchschlag für Heavy-Hörer zu sein.
Auch die Dynamik verdient ein Extra-Lob: Clean-Passagen sind nicht „Pause“, sondern Teil der Aussage. Heavy-Parts sind nicht „Belohnung“, sondern Konsequenz. Und über allem liegt ein Sounddesign, das die dunklere, immersivere Ausrichtung des Albums stützt: Hallräume werden dramaturgisch eingesetzt, Gitarrentexturen malen Atmosphäre, ohne den Punch zu opfern, und die Stimme sitzt so im Mix, dass jedes Wort Gewicht bekommt – selbst dann, wenn die Instrumente gerade alles in Schutt spielen.
Unsere Wertung:
➤ Songwriting: 8 von 10 Punkten
➤ Komposition:9 von 10 Punkten
➤ Musikalische Fähigkeit: 9 von 10 Punkten
➤ Produktion: 9 von 10 Punkten
➤ Gesamtwertung: 8,5 von 10 Punkten
Unser Fazit:
Dyed In Grey liefern mit Harbinger ein Album ab, das Progressive Metal nicht als Sport versteht, sondern als Erzählkunst. Die Platte ist technisch messerscharf, harmonisch farbig, atmosphärisch dicht – und emotional so greifbar, dass die dunklen Momente nicht nur „cool“ wirken, sondern wirklich etwas auslösen. Wer auf komplexe Arrangements, starke Dramaturgie und kompromisslose, zugleich elegante Heaviness steht, bekommt hier ein Werk, das man nicht nebenbei konsumiert, sondern erlebt.
Mehr zu Dyed In Grey im Netz:
Dyed In Grey bei Instagram:
https://www.instagram.com/dyedingrey/
Dyed in Grey bei Bandcamp:
https://dyedingrey.bandcamp.com/
Dyed In Grey bei Spotify anhören:
https://open.spotify.com/artist/1T8PR2VudWKHc1qoFO70um
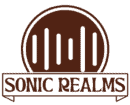
![SPEED LIMIT – Anywhere We Dare: Die Salzburger Melodic Metal-Pioniere kehren nach über 7 Jahren mit einem mächtigen Album zurück (Audio & Video) [ Hard Rock | Melodic Metal ]](https://sonicrealms.de/wp-content/uploads/2023/08/cover_1503482871715683.jpg.webp)
![SOULDRINKER – War Is Coming: Ein Sound so wundervoll wie gewaltig … (Audio & Video) [ Heavy Metal ]](https://sonicrealms.de/wp-content/uploads/2023/08/Cover-vorlaeufig-Kopie.jpg.webp)