Mit ihrem Debütalbum „The Scapegoat’s Agony“ (Im Original erschienen 1995 bei Impact Records) zeigt die Würzburger Band Coma Beach, dass Punk weit mehr sein kann als roher Lärm und spontane Wut. Hier trifft ein kantiger, druckvoller Punk- und Alternative-Sound auf ein überraschend literarisches Fundament: Anspielungen auf Samuel Beckett, Arthur Schopenhauer, Douglas Adams und sogar Shakespeare durchziehen die Songs und verleihen ihnen eine erzählerische und philosophische Tiefe, die man im Genre nicht alle Tage findet. Statt auf Provokation, seziert die Band menschliche Abgründe, Selbstzweifel, Realitätsflucht und gesellschaftliche Rollenspiele – und verpackt das Ganze in kompakte, düstere, treibende Songs, die trotzdem sofort packen. Wir haben uns mit der Band auf einen Plausch getroffen und die Vergangenheit von Coma Beach etwas beleuchetet
Hallo Coma Beach – danke, dass ihr euch Zeit nehmt!
Aber sehr gerne doch, Philipp!
Euer Debüt The Scapegoat’s Agony feiert 30 Jahre; warum habt ihr das Material mit der Scapegoat-Revisited-Trilogie (EPs 2024/25) neu editiert, und nach welchen Kriterien sind die Single-/Radio-Edits entstanden?
Die Idee einer Neubearbeitung spukte uns schon länger im Kopf herum. 30 Jahre später wollten wir das Album nämlich nicht einfach nur nostalgisch abfeiern, sondern es in eine Form bringen, die heute genauso funktioniert wie damals. Die Scapegoat-Revisited-EPs sind für uns so etwas wie eine Neu-Rahmung, sowohl soundtechnisch als auch visuell: Wir haben die Songs nicht neu erfunden, sondern sie klanglich geschärft und dramaturgisch neu sortiert sowie für jede EP und jeden Song ein eigenes Cover entworfen. Es ging darum, die Essenz von The Scapegoat’s Agony noch klarer herauszustellen – die Wucht, die Dunkelheit, aber auch die ironischen Brechungen.
Bei den Single- und Radio-Edits war die härteste Aufgabe, die Balance zu halten: Wie kürzt man, ohne den Kern zu verlieren? Wir haben uns gefragt: Welche Passagen tragen die Botschaft am stärksten, wo liegt die emotionale Spitze, und was kann man straffen, ohne dass der Song seine Zähne verliert? Am Ende sind es also keine weichgespülten Radio-Versionen geworden, sondern pointierte Verdichtungen – wie ein Schlaglicht auf das, was die Stücke im Kern ausmacht.
Neben der digitalen Überarbeitung war uns auch der thematische rote Faden sehr wichtig, der sich sowohl durch das Album als auch durch die Scapegoat-Revisited-Trilogie zieht: die überwiegend schmerzliche und leidvolle emotionale Odyssee des namenlosen Antihelden als Symbol für existentielle Aspekte des menschlichen Daseins. Genau das Richtige für einen gemütlichen Abend also 😉!
Der namenlose Antiheld, um den es sich in The Scapegoat’s Agony dreht, zieht sich als roter Faden durch das Album: War diese Figur als narratives Konzept von Anfang an geplant, oder hat sie sich erst im Schreibprozess herauskristallisiert?
Eher Letzteres, zumal die 13 Songs damals über einen Zeitraum von etwa 1½ Jahren entstanden sind. Eine gewisse Grundphilosophie war natürlich schon in unseren Anfangstagen vorhanden — da wäre zum einen der konsequent künstlerisch-literarische Ansatz beim Verfassen von Texten, geprägt von einigen unserer Lieblingsautoren wie Samuel Beckett, Franz Kafka, Douglas Adams oder William Shakespeare; dazu kam noch unser großes Interesse an den düsteren und tragischen Aspekten der menschlichen Existenz, beeinflusst von Philosophen wie Schopenhauer, Sartre oder Camus. Auch einige unserer musikalischen Einflüsse (u.a. Sex Pistols, Therapy?, Joy Division, The Cure) haben sicherlich zu der insgesamt düsteren und pessimistischen Grundstimmung unserer Texte wie auch unserer Musik beigetragen.
Lest HIER unsere Kritik zu The Scapegoats Agony
The Scapegoat’s Agony
Im Laufe des Schreibprozesses wurde uns zunehmend klar, dass sich da eine Figur herauskristallisiert – jemand, der all diese Brüche, Widersprüche und Verzweiflung in sich trägt. Irgendwann haben wir dann gemerkt: Das ist kein loses Sammelsurium mehr, sondern eine Art roter Faden, der das Album zusammenhält. Der namenlose Antiheld ist so etwas wie ein Spiegel, in dem sich die Songs bündeln – ein Charakter, der gleichzeitig Projektionsfläche und Zerrbild ist. Im Detail geplant war das nicht, aber wahrscheinlich genau deshalb wirkt es so organisch: Die Figur ist aus den Texten gewachsen, nicht umgekehrt.
Bei der Entscheidung über die endgültige Reihenfolge der Songs auf unserem Album waren dann neben den thematischen Bezügen vor allem auch musikalische Aspekte ausschlaggebend. Im Nachhinein ist es zugegebenermaßen immer noch ziemlich erstaunlich für uns alle, wie gut die einzelnen Songs sowohl thematisch als auch musikalisch aufeinander aufbauen, um eine stimmige und in sich logische Geschichte zu erzählen. Langer Rede kurzer Sinn: nicht exakt geplant, aber dankend angenommen.
Ihr nennt Beckett, Schopenhauer, Douglas Adams und Shakespeare als Bezugspunkte – wie übersetzt ihr Existenzialismus, Pessimismus und Satire konkret in Reim, Metrik und Refrainstruktur?
Natürlich haben wir uns nie hingesetzt und gesagt: „So, jetzt machen wir mal Beckett und Schopenhauer in Reimform.“ Aber klar, diese Einflüsse sind da und färben die Art, wie wir unsere Songtexte schreiben. Beckett bringt dieses Gefühl von Absurdität und Ausweglosigkeit rein – kurze, abgehackte Zeilen, die wie ein Echo im Kopf hängen bleiben (z.B. „Another Song“). Schopenhauer steckt in der Grundstimmung: der Pessimismus, der sich in wiederholten Refrains wie eine Spirale nach unten zieht (z.B. „Extreme Masochist“). Douglas Adams liefert uns den absurden Humor, den wir in manchen Reimen oder schrägen Bildern verstecken – so eine Art „kosmischer Witz“, der erst beim zweiten Hinhören auffällt (z.B. „I Won’t Listen“). Und Shakespeare? Der hat uns die Lust an der großen Geste beigebracht: Pathos, Rhythmus, manchmal fast schon theatralische Refrainstrukturen (z.B. „Jesus’ Tears“). Am Ende ist es eine Mischung aus existenzieller Schwere mit einer Prise satirischem Augenzwinkern – und genau das macht für uns den Reiz aus.
In The Past Of The Future wird Vergangenheit als personifizierte Bedrohung gezeichnet („writing on your wall“, „room of glass“): Ist dieses „Er“ psychologisch, politisch oder moralisch zu lesen?
Wir würden das gar nicht auf eine einzige Ebene festlegen. „Er“ ist so eine Art Chamäleon: mal dein eigenes schlechtes Gewissen, mal die verdrängte Geschichte einer Gesellschaft, mal die moralische Stimme, die du am liebsten zum Schweigen bringen würdest. Psychologisch steckt da so einiges drin – die Vergangenheit, die du nicht loswirst, ein Trauma, das dich Tag und Nacht verfolgt, ein schwerer Fehler, der sich nicht wiedergutmachen lässt. Politisch kann man’s genauso lesen: Systeme, die ihre Fehler nicht aufarbeiten, werden irgendwann von genau diesen Fehlern heimgesucht. Und moralisch ist es ein Schlag ins Gesicht: Wer glaubt, sich mit Geld oder Ignoranz freikaufen zu können, wird am Ende trotzdem eingeholt. Uns gefällt, dass die Figur gleichzeitig persönlich und universell wirkt – wie ein Schatten, der immer größer wird, je mehr du ihn ignorierst.
Nothing Right konfrontiert sich mit Schuld („why I’m a murderer“) – ist das die Sprache eines inneren Tribunals, eine Metapher für Selbstsabotage, oder beides?
Für uns ist das ganz klar beides. Der Song klingt wie ein inneres Tribunal, in dem man sich selbst anklagt und verurteilt – diese Stimme im Kopf, die dir ständig sagt, dass du alles falsch machst. Gleichzeitig steckt da aber auch die Metapher für Selbstsabotage drin: dieses Gefühl, sich selbst im Weg zu stehen, immer wieder dieselben Fehler zu machen und am Ende der eigene „Mörder“ zu sein – nicht im wörtlichen Sinn, sondern weil man seine Chancen, seine Träume oder sein Selbstvertrauen tötet. Wir wollten diese Spannung zwischen Selbstanklage und Selbstzerstörung offenhalten, weil viele Leute genau das kennen: der Kampf mit sich selbst, der nie so richtig aufhört.

Mind Descending und A Madman’s Dream wirken wie Zwillinge von klinischer Diagnose und innerer Zersetzung: Welche Erfahrungen oder Quellen standen hinter der Bildwelt von Weißkittel, Röntgenblick und Nacht-Schreien?
Wir haben bei beiden Songs bewusst mit dieser Bildwelt gespielt, die irgendwo zwischen Klinikflur und Albtraum liegt. Der „Weißkittel“ ist dabei weniger ein konkreter Arzt als vielmehr ein Symbol für das Gefühl, ausgeliefert zu sein – jemand anders schaut durch dich hindurch, stellt Diagnosen, während du selbst kaum noch Kontrolle hast. Der „Röntgenblick“ steht für dieses gnadenlose Durchleuchten, das keine Geheimnisse mehr zulässt, und die „Nacht-Schreie“ sind die Kehrseite davon: das, was rausbricht, wenn du dich nicht mehr schützen kannst.
Die Quellen sind also nicht eine bestimmte Erfahrung, sondern eher ein Mix aus Eindrücken: Filme, Literatur, persönliche Beobachtungen, aber auch das allgemeine Gefühl, dass unsere moderne Gesellschaft oft wie eine riesige Klinik funktioniert – mit Regeln, Diagnosen und Schubladen, in die man gesteckt wird. „Mind Descending“ ist dabei mehr das innere Protokoll des Zusammenbruchs, während „A Madman’s Dream“ die Horrorfilm-Version davon liefert – ein Fiebertraum, in dem Realität und Wahn ineinanderfließen. Uns hat gereizt, diese beiden Perspektiven nebeneinanderzustellen: nüchterne Diagnose und totale Eskalation.
Jesus’ Tears verbindet Evangelienbilder, Engel und Vergeltung: Wo zieht ihr für euch die Grenze zwischen Sakrileg, Mythos und ambivalenter Moral – und welche Reaktionen habt ihr auf den Song erlebt?
Für uns war „Jesus’ Tears“ nie als billige Provokation gedacht, sondern als Spiel mit ausdrucksstarken Bildern, die viele Leute sofort erkennen. Wir greifen Symbole aus den Evangelien auf, aber nicht, um sie zu entweihen, sondern um sie in eine andere, dunklere Erzählung zu integrieren – irgendwo zwischen Mythos, persönlichem Albtraum und moralischem Dilemma. Die Grenze ziehen wir da, wo es platt oder respektlos würde; uns geht’s um Ambivalenz, nicht um Blasphemie. Der Song stellt die Frage: Was passiert, wenn Erlösung ausbleibt und nur Vergeltung bleibt?
Die Reaktionen waren entsprechend gemischt: Einige fanden es ziemlich heftig, manchmal fast schon verstörend, andere haben genau diesen Zwiespalt gefeiert – dass man gleichzeitig biblische Bilder erkennt und doch in einer ganz anderen, zerrissenen Welt landet. Uns hat diese Art von Feedback immer sehr gefallen, weil es zeigt, dass der Song nicht einfach durchläuft, sondern hängenbleibt und Diskussionen auslöst.
Astray (Fallen Angel) nimmt Heilsversprechen und Kommerz aufs Korn („property kills your glorious rebirth“): Hattet ihr konkrete Vorbilder (Prediger, Politik, Kultfiguren) oder ist es ein archetypischer „falscher Messias“?
Wir hatten beim Schreiben keine konkrete Person im Kopf, sondern eher diesen Archetyp des „falschen Messias“, der überall auftaucht – ob in Religion, Politik oder Popkultur. Es geht um Figuren, die dir Erlösung versprechen, aber im gleichen Atemzug die Hand aufhalten. Dieses Muster ist so universell, dass man es sofort erkennt: große Worte, Heilsversprechen, und am Ende läuft’s auf Kontrolle und Besitz hinaus. Uns hat gereizt, diese Figur in den Song zu packen – teils Prediger, teils Verkäufer, teils Showmaster. Also eigentlich mehr Karikatur als Porträt. Gerade die letzten Jahre haben ganz deutlich gezeigt, dass diese Art von Blendern und Rattenfängern leider immer noch nicht aus der Mode gekommen ist.
Bliss attackiert die Verführung der Selbstbetäubung („Kill your thoughts…“): Wie sehr ist das auch Kritik an Aufmerksamkeitsökonomie und Algorithmus-Komfortzonen im Jahr 2025?
Wir hatten schon damals – im Jahr 1995 – beim Schreiben das Gefühl, dass die Welt immer mehr in diese „blissful pink“-Zone abdriftete – alles schön weichgezeichnet, Hauptsache bequem, Hauptsache nicht zu viel denken. Die Zeile „Kill your thoughts to free your mind“ ist somit nach wie vor ein bitter-sarkastischer Slogan für die mediale/digitale Dauerberieselung: Scrollen statt reflektieren, konsumieren statt konfrontieren. Die Algorithmen liefern genau das, was dich ruhigstellt bzw. deine Vorurteile bestätigt – und du denkst, du bist frei, weil du nicht mehr zweifelst. Für uns war und ist das keine Zukunftsvision, sondern Gegenwart. „Bliss“ ist unser Versuch, diesen Zustand zu sezieren – mit einem zynischen Lächeln, das weh tut.
Extreme Masochist stellt Schmerz als Wahrheits- und Reinigungsritual dar („Life is pain“): Philosophische Setzung à la Schopenhauer, punkiges Statement – oder beides, und wie setzt ihr das klanglich um?
Für uns ist das ganz klar beides. Einerseits steckt da diese Schopenhauer-Idee drin: Schmerz als Grundbedingung des Lebens, als etwas, das man nicht wegdiskutieren kann. Andererseits ist es auch ein klassisches Punk-Statement – direkt, kompromisslos, ohne Schnörkel: „Life is pain.“ Punkt. Musikalisch haben wir das so umgesetzt, dass der Song wie ein Schlag ins Gesicht wirkt: hartes Riffing, monotone Wucht, keine Fluchtwege. Wir wollten, dass man den Schmerz nicht nur hört, sondern körperlich spürt – fast wie ein Ritual, das dich durchrüttelt.
Absurd feuert gegen Nachleben-Hoffnung, Bücherkult und Wohlstandsjagd: Was hat sich seit 1995 an euren „Absurditäten“ geändert – und was ist erschreckend zeitlos geblieben?
Als wir „Absurd“ Mitte der 90er geschrieben haben, war das so eine Abrechnung mit den großen Illusionen: die Hoffnung aufs Jenseits, der Glaube an ewige Wahrheiten in Büchern, und natürlich die Jagd nach Status und Reichtum. Heute, 30 Jahre später, hat sich die Verpackung geändert – statt Bücherkult gibt’s jetzt Social-Media-Gurus, statt Wohlstandsjagd die permanente Selbstoptimierung. Aber das Grundmuster ist dasselbe geblieben: Menschen klammern sich an Versprechen, die sie von der Endlichkeit der menschlichen Existenz ablenken sollen.

Erschreckend zeitlos ist genau das: die Angst vor dem Nichts und der Versuch, sie mit Konsum, Ideologien oder Ersatzreligionen zu übertünchen. Wenn wir „Absurd“ heute anschauen, wirkt der Song fast aktueller als damals – nur dass die „brave new fucking world“ inzwischen noch lauter, schneller und digitaler geworden ist.
Another Song schneidet Werbeslogans gegen existenzielle Leere: Wie habt ihr diesen zynisch-grotesken Ton im Studio und live in Energie übersetzt, ohne die Linie zum reinen Nihilismus zu überschreiten?
Uns ging’s darum, die Absurdität dieser Werbesprache so überdreht wie möglich zu spiegeln – diese „Congratulations“-Mantras, die dir ein perfektes Leben verkaufen wollen, während drumherum alles zerfällt. Im Studio haben wir das mit einem sehr klaren, pop-punkartigen Sound umgesetzt: flottes Tempo, flirrende akustische Gitarren, Vocals, die zwischen Spott und Resignation pendeln. Live funktioniert das, weil die Energie sofort ins Publikum springt – es ist weniger „alles ist sinnlos“ als vielmehr „schaut mal, wie grotesk das alles ist“. Der Song lebt von dieser Spannung: er lacht über den Abgrund, statt einfach nur hineinzustarren.
I Won’t Listen: Ist das konsequente Nicht-Zuhören Schutzstrategie gegen Dauerbeschallung und Sozialdruck – oder kalkulierte Misantrophie? Wie bildet ihr diese Müdigkeit in Arrangement und Dynamik ab?
Für uns ist das eher eine Schutzstrategie, die aber natürlich mit einer guten Portion Zynismus aufgeladen ist. „I Won’t Listen“ ist dieses trotzig-passive Statement: Ich verweigere mich dem Dauerrauschen, den Erwartungen, dem ständigen Gelaber – und ja, das klingt misanthropisch, aber es ist vor allem Selbstverteidigung. Musikalisch haben wir das so umgesetzt, dass die Müdigkeit – zumindest im ersten Songdrittel – fast körperlich spürbar wird: ein stoisches, gleichförmiges Riff, das sich wie eine Wand vor dich stellt, dazu Vocals, die zwischen gelangweilter Abweisung und aggressivem Ausbruch pendeln. Die Dynamik bleibt zunächst bewusst reduziert, um dann im zweiten Teil mit einer gezielten Tempoverschärfung zu explodieren. Es ist kein Song, der den Adressaten aufbaut, sondern einer, der ihm ins Gesicht sagt: „Ich hab die Schnauze voll – und ich hör dir nicht mehr zu.“
Gegründet 1993 in Würzburg, 1996 aufgelöst, seit 2021 digitale Re-Releases und seit 2023 Singles/EPs über DistroKid – was bedeutet Coma Beach heute praktisch: neues Material, Konzerte, Line-up-Varianten oder ein bewusst kuratierter Katalogabschluss?
Für uns fühlt sich Coma Beach heute weniger wie eine aktive Band im klassischen Sinn an, sondern eher wie ein bewusst kuratierter Katalog, den wir Stück für Stück ins Hier und Jetzt geholt haben. Wir haben uns entschieden, die Songs nicht einfach im Archiv verstauben zu lassen, sondern sie digital neu zu veröffentlichen, zu rahmen und damit auch neu erfahrbar zu machen. Das ist sozusagen unser Abschluss in kuratierter Form – ein bewusstes „Hier, das ist unser Werk, so wollen wir es stehen lassen“.
Neue Songs oder ein Comeback-Line-up sind aktuell für uns kein Thema. Uns ging es darum, das, was wir damals geschaffen haben, in einer Form zu präsentieren, die heute Sinn ergibt – ohne Nostalgie-Filter, aber mit Respekt vor dem Ursprung. Insofern ist Coma Beach 2025 kein „Work in Progress“ mehr, sondern ein abgeschlossenes Kapitel, das wir jetzt so aufbereitet haben, dass es für alte wie neue Hörerinnen gleichermaßen funktioniert.*
Zum Abschluss: Welche letzten Worte möchtet ihr unseren Leser:innen mitgeben – eine Botschaft, ein Statement oder eine Einladung, wo man euch aktuell am besten hören und verfolgen kann?
Wenn ihr bis hierhin gelesen habt: Danke fürs Dranbleiben! Unsere Songs sind nie leichte Kost, aber genau das macht für uns den Reiz aus – sie sollen Fragen aufwerfen, zum Nachdenken anregen und immer wieder auch einfach nur den Staub aus euren Ohren pusten. Wer Lust hat, tiefer einzutauchen, findet unser komplettes Material auf allen gängigen Streaming-Plattformen, von Spotify und YouTube über Apple und Amazon bis hin zu Bandcamp und Deezer. Wer mehr über unsere Texte erfahren möchte, dem empfehlen wir unsere Lyricseiten auf Genius.com, da findet ihr umfangreiche Infos zu unseren literarischen, philosophischen und popkulturellen Einflüssen bzw. Verwandten.
Wir sehen Coma Beach heute als kuratierten Katalog, ein abgeschlossenes Kapitel, das wir bewusst so stehen lassen. Also: hört rein, entdeckt die Songs neu oder wieder, und wenn ihr euch dabei aufregt, lacht, nachdenkt oder hemmungslos headbangt – umso besser. Das ist alles, was wir uns wünschen.
Vielen Dank für eure Zeit und das Gespräch! Wer jetzt noch mehr über die Punkphilosophen erfahren möchte, der sollte dringend folgende Links auschecken:
Mehr zu Coma Beach Im Netz:
Coma Beach bei Instagram:
https://www.instagram.com/coma.beach/
Coma Beach bei Bandcamp:
https://comabeach.bandcamp.com
Coma Beach bei Spotify anhören:
https://open.spotify.com/artist/0xktqq74a4oPs3L6ITAGaI
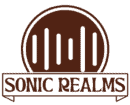
![BOWMEN – Mission 27° 59′ 17″ N 86° 55′ 31″ E: Auf dem Dach der Welt (Audio & Video) [ Alternative Rock | Blues Rock | Psychedelic Rock ]](https://sonicrealms.de/wp-content/uploads/2023/08/cover2.jpg.webp)
![SLEARS – Turbulent Waters: Ein stimmgewaltiger Sänger, zwei versierte Gitarristen und eine unaufhaltsam groovende Rhythmusgruppe (Audio & Video) [ Heavy Metal | Hard Rock | Alternative Rock ]](https://sonicrealms.de/wp-content/uploads/2023/09/COVER.webp)